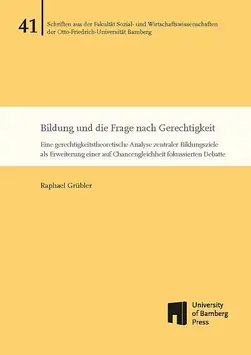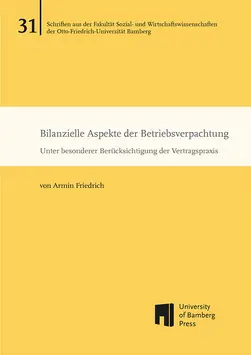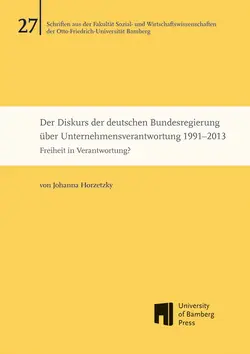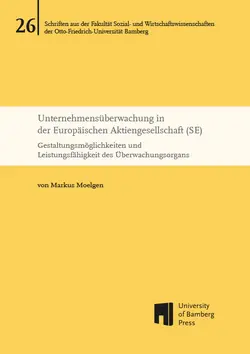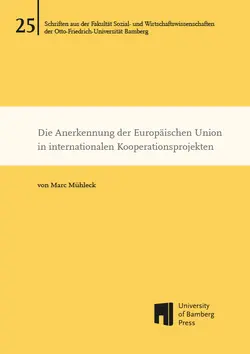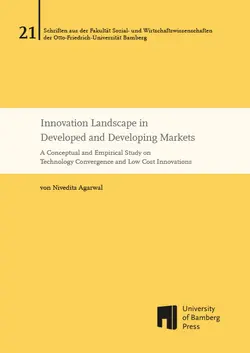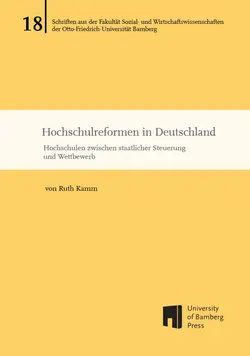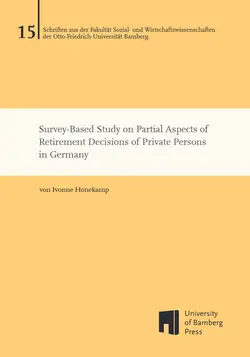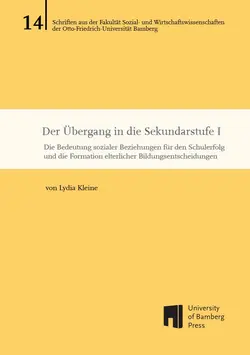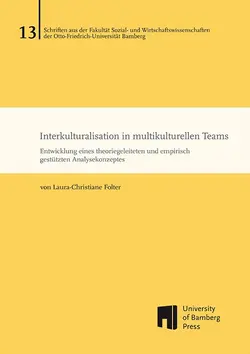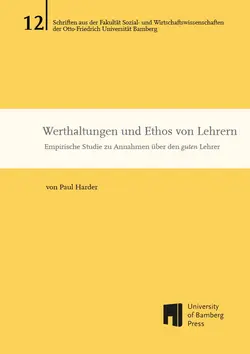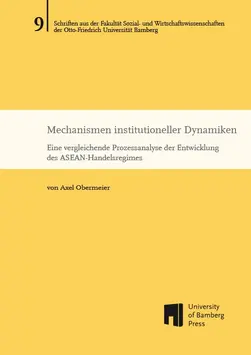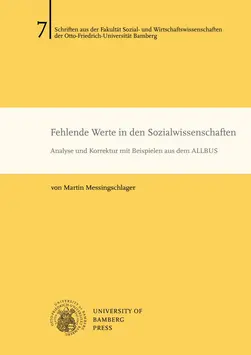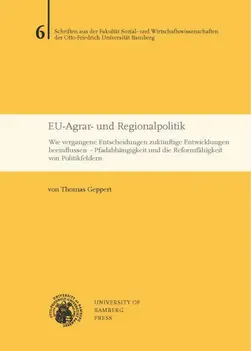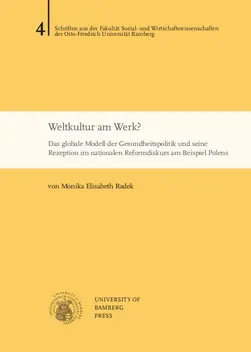Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
Die Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg (SSoWi) spiegeln den aus der besonderen F?cherkombination der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften resultierenden multiperspektivischen Blick auf die Gesellschaft und ihre wirtschaftlichen, sozialen und politischen Zusammenh?nge, insbesondere auch zu Fragestellungen, die aus dem Zusammenwachsen Europas und der Globalisierung resultieren.
ISSN: 1867-6197, eISSN: 2750-8536
Schriftenreihe im Forschungsinformationssystem (FIS) der Universit?t
Bisher erschienene B?nde
Bildung und die Frage nach Gerechtigkeit : Eine gerechtigkeitstheoretische Analyse zentraler Bildungsziele als Erweiterung einer auf Chancengleichheit fokussierten Debatte / Raphael Gr��bler
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2022
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 41)
978-3-86309-870-4
Preis: 25,00 �
Die Dissertation greift das Thema Bildungsgerechtigkeit auf. Eine g?ngige Deutung gerechter Bildung, die vor allem in der politisch einflussreichen PISA-Studie vorgenommen wird, beschr?nkt den Gerechtigkeitsgedanken auf den Aspekt der Chancengleichheit. Ausgangspunkt der Dissertation ist daran ankn��pfend die These, dass eine alleinige Konzentration auf den bildungsbezogenen Einfluss der sozialen Herkunft, nicht ausreichend ist. Denn eine auf Chancengleichheit reduzierte Gerechtigkeitsbewertung vernachl?ssigt weitere zentrale Bildungsgedanken und damit verbundene Gerechtigkeitsimplikationen.
Der Fokus der Dissertation liegt auf der Analyse der wesentlichen Gerechtigkeitsimplikationen des Bildungsgedankens und dessen zentralen Zielwerten. Es wird erstens untersucht, welche wesentlichen Zielvorstellungen der Bildungsgedanke beinhaltet und welche Gerechtigkeitsurteile dies zur Folge hat. Zweitens wird dar��ber hinaus anhand der PISA-Daten er?rtert, ob eine solch erweiterte Deutung von Bildungsgerechtigkeit im Vergleich zu einer alleinigen Konzentration auf Chancengleichheit abweichende Gerechtigkeitseinsch?tzungen zur Folge hat.
Zugriff auf den Volltext:
https://doi.org/10.20378/irb-54598
Innovationsmanagement im bayerischen Berufsbildungssystem : eine rekonstruktive Studie zur Implementierung von Innovationen an bayerischen Berufsschulen / Matthias F��nffinger
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2021
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 40)
978-3-86309-813-1
Preis: 34,00 �
Die digitale Transformation wirkt sich in allen Lebensbereichen aus. Sie hinterl?sst ihre Spuren mittlerweile nicht nur in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft; auch in der Bildung werden immer mehr Innovationsprozesse angesto?en, um Themen der Digitalisierung zeitgem?? abzubilden und umzusetzen. Dies betriff vor allem die wichtigste Schnittstelle zwischen Unternehmen und Schulen: die berufliche Bildung.
Die vorliegende Studie besch?ftigt sich mit der Gestaltung von Innovationsprozessen im Bayerischen Berufsschulsystem am Beispiel des verbindlichen Medienkonzepts. Sie betrachtet die Organisation dieser Prozesse von der Makro- bis zur Mesoebene und fokussiert dabei auf die Akteure und ihr Innovationshandeln vor dem Hintergrund aktueller Erkenntnisse des Neo-Institutionalismus sowie der Educational-Governance-Forschung.
Nach einer eingehenden Beschreibung des Forschungsfeldes, sprich des Medienkonzepts, seiner Voraussetzungen, seiner Zielsetzung, seiner Entwicklung und der Rahmenbedingungen seiner Einf��hrung folgt eine Rekonstruktion theoretischer Erkenntnisse zu Innovationsprozessen in Bildungsorganisationen. Anschlie?end wird die Durchf��hrung einer empirischen Untersuchung beschrieben, deren Ergebnisse Hinweise auf das Innovationshandeln der betroffenen Akteure von der Makro- bis zur Mesoebene geben sollen. Hierbei wird insbesondere den Wahrnehmungen und Einsch?tzungen der Akteure zu den Gelingensbedingungen von Innovationen Raum gegeben.
Abschlie?end werden die Ergebnisse der theoretischen und der empirischen Rekonstruktion kontrastiert und Hemmnisse bzw. Treiber erfolgreichen Innovationshandelns in Bayerischen Berufsschulen identifiziert.
Zugriff auf den Volltext:
https://doi.org/10.20378/irb-51437
Der Einfluss des wahrgenommenen Alterns auf die Akzeptanz von Smart-Home-Technologien: Wirkung der Future Time Perspective auf das Technology Acceptance Model / Falk Andreas Eichner
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2021
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 39)
978-3-86309-797-4
Preis: 32,00 �
Die bis dato eher verhaltene Nachfrage nach Smart-Home-Systemen gibt Anlass zu der Frage nach den ma?geblichen Adoptionsbarrieren. In Anbetracht des potentiellen Nutzens dieser Technologien f��r das Leben der Bewohner �C besonders auch im fortschreitenden Alter �C besteht dar��ber hinaus Forschungsbedarf, ob und in welcher Art sich das Alter(n) auf die Technologieakzeptanz auswirkt. Insbesondere sind auf subjektiver Wahrnehmung basierende Alterskonstrukte bisher kaum im Zusammenhang mit der Technologieadoption untersucht worden.
Die Arbeit befasst sich mit den Determinanten der Akzeptanz von Smart-Home-Anwendungen seitens potentieller ?bernehmer anhand popul?rer Theorien und Modelle zum individuellen Adoptionsverhalten und mit Blick auf die Einflusswirkung des chronologischen Alters bzw. des subjektiv empfundenen Alterns. Das gew?hlte Untersuchungsmodell basiert auf dem in der wissenschaftlichen Forschung weit verbreiteten und empirisch bew?hrten Technology Acceptance Model (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). Zus?tzlich werden alternativ externe Variablen in Form des chronologischen Alters bzw. der Future Time Perspective (Carstensen & Lang, 1996) einbezogen, um insbesondere die Wirkung auf den wahrgenommenen Nutzwert und die empfundene Einfachheit der Nutzung von Hausautomatisierung zu untersuchen. Betrachtetet werden zudem Mediator- und Moderatoreffekte hinsichtlich der nachgelagerten Einstellungsbildung und ?bernahmeintention.
Die Ergebnisse st��tzen die Hypothese, dass die subjektive Future Time Perspective (mit Blick auf die im Leben verbleibenden M?glichkeiten) einen gr??eren Erkl?rungsbeitrag zur individuellen Adoption von Smart Home-Systemen leisten kann als das chronologische Alter.
Zugriff auf den Volltext:
https://doi.org/10.20378/irb-49946
Redistributive Taxation in Dynamic General Equilibrium with Heterogeneous Agents / Christian Putz
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2019
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 38)
978-3-86309-702-8
Preis: 24,00 �
The consideration of the distribution of income, wealth and consumption within countries around the globe reveals one basic and consistent picture: inequality in the allocation of resources is a prevailing global phenomenon and subject to an ongoing negative trend since, at least, the last three decades. In general, governments are equipped with a range of instruments and tools to influence distribution, with redistributive tax systems being considered the most direct, powerful and popular instrument in this context. Besides its influence on resource allocation, however, tax and transfer policies also possess substantial effects on many economic areas, for example, economic growth, financial markets and individual as well as aggregate welfare.
Although widely discussed, the effects of taxation and redistribution as well as the underlying causes are not yet fully understood. By the means of economic equilibrium models the present work, therefore, addresses the influence of redistributive taxation within a closed economy populated by heterogeneous agents. The results show that rising tax rates on labor income or capital gains are generally associated with decreasing economic growth rates and, hence, diminishing future consumption possibilities. Moreover, in a variety of cases, redistributive taxation might foster inequality in wealth, consumption and participation rates. Even when effective, redistributive taxation is generally associated with a trade-off between macroeconomic growth and equality (or welfare).
Zugriff auf den Volltext:
https://doi.org/10.20378/irb-46651
Du und Dein Stress : Eine soziologische Rekonstruktion des Burnout-Diskurses und der Arbeit am inneren Gleichgewicht / von Alexander Hirschfeld
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2019
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 37)
978-3-86309-678-6
Preis: 23,00 �
Der Begriff Burnout bringt wie kein anderer die psychischen Leidenserfahrungen an gegenw?rtigen Arbeitsbedingungen auf den Punkt. Aber wie kann man dem Problem beikommen und wer ist hier ��berhaupt zust?ndig? Die vorliegende Arbeit adressiert diese Fragen aus wissenssoziologischer Perspektive. Anstatt selbst im Diskurs mitzumischen, wird rekonstruiert, welche Denkweisen die Debatte dominieren. Wie die Ergebnisse zeigen, ist der Diskurs vor allem von einer Orientierung am autonomen Subjekt und dem Ideal der ?Arbeit am inneren Gleichgewicht�� gepr?gt, das den Umgang mit Stress als Prozess der Selbsterfahrung und ?konomischen Bilanzierung erscheinen l?sst. Diese Sprache der pers?nlichen Wahrnehmung verbannt jede Objektivierung psychischer Belastung aus dem Diskurs; anstatt von der Arbeit ��berfordert, erscheinen Burnout-Betroffene als Sklaven der eigenen Erwartungen. Durch diese Individualisierung und Normalisierung des Problems werden die Perspektiven andere Professionen, insbesondere die der Soziologie und der Medizin, marginalisiert. Der Burnout-Diskurs ist dabei kein singul?res Ph?nomen, sondern zeitdiagnostisch wesentlich breiter einzuordnen. Er ist Ausdruck eines generellen Aufstiegs der 188bet������������_188����ƽ̨-Ͷע*���� seit Mitte des 20. Jahrhunderts, die einen der wichtigsten Faktoren beim R��ckbau sozial- und wohlfahrtstaatlicher Institutionen darstellt.
Zugriff auf den Volltext:
https://doi.org/10.20378/irbo-55568
Pflegewissenschaftliche Anspr��che in der Unterrichtsplanung : eine empirische Untersuchung / von Julia Simon
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2019
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 36)
978-3-86309-642-7
Preis: 26,50 �
Die Thematik ?pflegewissenschaftliche Anspr��che in der Unterrichtsplanung�� greift ein Thema auf, dem aktuell und vor dem Hintergrund der Akademisierungs- und Professionalisierungsbestrebungen der Pflegeberufe eine hohe Bedeutung beigemessen wird. Bereits jetzt sollten Pflegende in der Lage sein, ihr pflegerisches Handeln und die getroffenen Entscheidungen (pflege-)wissenschaftlich zu begr��nden. K��nftig wird neben der bestehenden Berufsfachschulausbildung die akademische Pflegebildung gesetzlich festgelegt und es besteht Einigkeit dar��ber, dass Pflegewissenschaft die zentrale Bezugsdisziplin der Bildungsg?nge in den Pflegeberufen und demzufolge auch der lehrerbildenden Studieng?nge der Fachrichtung Pflege darstellt. Problematisch ist allerdings, dass ein gemeinsames Verst?ndnis von pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen sowohl durch die heterogene Ausbildung der Lehrenden als auch durch die derzeit noch wenig bestehende Klarheit ��ber die Einordnung und die bildungsdidaktische Vermittlung der Disziplin Pflegewissenschaft erschwert ist. Im Kontext dieser Problemstellung wird der Frage nachgegangen, inwiefern pflegewissenschaftliche Erkenntnisse bei der inhaltsbezogenen Unterrichtsplanung sowie im Unterricht von Lehrenden im Berufsfeld Pflege ber��cksichtigt werden. Die vorliegende Arbeit, die forschungsmethodologisch der Grounded Theory folgt, liefert auf der Basis von umfangreichem Datenmaterial ein theoretisches Modell zu pflegewissenschaftlichen Anspr��chen an die Unterrichtsplanung. Bedeutsam ist hier das zentral identifizierte Ph?nomen der ?tendenziellen Vermeidung�� des Einbezugs pflegewissenschaftlicher Erkenntnisse in die Unterrichtsplanung. Infolgedessen werden konkreten Empfehlungen zur k��nftigen Gestaltung und Reflexion angeboten.
Zugriff auf den Volltext:
https://doi.org/10.20378/irbo-54150
Einstellungen zur Kernenergie im internationalen Vergleich : Politisierungsniveaus, gegenstandsspezifische Salienz und nukleare Zwischenf?lle / von Marco Meyer
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2018
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 35)
978-3-86309-543-7
Preis: 25,00 �
Die Untersuchung widmet sich energiepolitischen Einstellungen im internationalen Vergleich am Beispiel der Sachfrage Kernenergie �C sowohl in Abwesenheit von exogenen Schocks als auch im Kontext nuklearer Zwischenf?lle. Da davon auszugehen ist, dass B��rger energiepolitischen Themen nicht zwangsl?ufig eine hohe Bedeutung beimessen, werden die Implikationen der relativen Sachfragensalienz, insbesondere mit Blick auf Politisierungsunterschiede, aus verschiedenen Perspektiven theoretisch diskutiert. Die empirische Analyse f��r ?ruhige Phasen�� offenbart markante kontextspezifische Einflussmuster bei der individuellen Verkn��pfung von Voreinstellungen und der Technologiebewertung. Theoretische Wirkungsmechanismen, die in der Literatur oftmals pauschal angenommen werden, treten empirisch vornehmlich in ?konomisch fortschrittlichen Staaten auf. Anhand des Fukushima-Ungl��cks zeigt die Untersuchung anschlie?end, dass Einstellungs- und politische Verhaltensreaktionen als das Resultat eines komplexen Wechselspiels aus Elitenbotschaften, individuellen Voreinstellungen und der langfristigen Salienzdynamik verstanden werden m��ssen. Auf Basis von drei Fallstudien wird deutlich, dass von einer Salienzsteigerung h?chstens im unmittelbaren Kontext eines nuklearen Zwischenfalls auszugehen ist. Da kontextspezifische Politisierungsprozesse f��r diverse Sachfragen vorstellbar sind, insbesondere f��r vergleichsweise spezielle Fragen der politischen Auseinandersetzung, beinhaltet die Untersuchung Implikationen, die ��ber das Fallbeispiel Kernenergie hinausweisen.
Zugriff auf den Volltext:
https://doi.org/10.20378/irbo-50873
Entscheidungsprozesse im strategischen W?hrungsmanagement internationaler Unternehmen : Ein Vergleich zwischen Automobilherstellern und Airlines mit Fokus auf realwirtschaftlichem Hedging / von Daniel Kaumanns
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2018
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 34)
978-3-86309-539-0
Preis: 25,50 �
In der vorliegenden Dissertation werden die Entscheidungsprozesse im strategischen W?hrungsmanagement internationaler Unternehmen betrachtet. Dabei liegt der Fokus auf der Auswahl, Anwendung und Evaluation von realwirtschaftlichen Hedgingstrategien (z. B. Natural Hedging). Im Rahmen einer vergleichenden Fallstudienanalyse werden Interview- und Unternehmensberichtsdaten erhoben und die empirischen Ergebnisse der Unternehmen aus der Automobil- mit denen aus der Airline-Branche verglichen. Auf dieser Basis werden wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen einer Produktions- und einer Dienstleistungsbranche in Bezug auf das strategische W?hrungsmanagement herausgearbeitet und unternehmenspolitische Implikationen formuliert.
Zugriff auf den Volltext:
https://doi.org/10.20378/irbo-50832
KriMI: A Multiple Imputation Approach for Preserving Spatial Dependencies : Imputation of Regional Price Indices using the Example of Bavaria / von Sara Bleninger
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2017
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 33)
978-3-86309-523-9
Preis: 22,50 �
Multiple imputation is a method to handle the problem of missing values in a dataset. As it accounts for the uncertainty brought in by the missing data, it is possible to conduct reliable statistical tests after this method has been implemented. Kriging uses neighbourhood effects to predict values of unobserved regions. It can be seen as an imputation technique. The unobserved regions are missing data points, and the kriging predictions are the imputations. Due to the fact of being a single imputation technique, no proper statistical inferences are possible after filling the dataset. If spatially dependent data face the problem of missing data and a proper statistical inference is needed, a modelling of the spatial correlation in the multiple imputation model is needed. Here this is prevailed by implementing kriging in the model used for multiple imputation. We call the resulting method KriMI. The exact problem can be found when looking at regional price levels in Bavaria. The Bavarian State Office for Statistics surveys the prices which are needed to compute the price index only in a few regions. The prices of the unobserved regions are treated as missing data.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-502980
Die Integrationsdynamik des Europ?ischen Emissionshandelssystems / von Irene Haller
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2017
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 32)
978-3-86309-521-5
Preis: 25,00 �
Das Europ?ische Emissionshandelssystem hat sich seit seiner Einf��hrung 2005 grundlegend gewandelt. Die 2003 beschlossene Richtlinie zur Einf��hrung eines europ?ischen Emissionshandelssystems kann dabei als kleinster gemeinsamer Nenner bewertet werden, denn wichtige Mitgliedstaaten stehen dem Konzept des Emissionshandels skeptisch gegen��ber. So enth?lt das Handelssystem lasche Regelungen und bel?sst zentrale Befugnisse sowie gro?e Handlungsspielr?ume bei den Mitgliedstaaten. Nur sechs Jahre sp?ter fordern die gleichen Mitgliedstaaten ein System mit strikten Regelungen und beschlie?en eine neue Richtlinie, die sie im k��nftigen Handelssystem vollst?ndig entmachtet. Was hat zu dieser Entwicklung gef��hrt und wie kann diese nachgezeichnet und erkl?rt werden? Dieses Buch deckt die Integrationsdynamik der Institution Emissionshandel auf europ?ischer Ebene inkrementell auf. Hierzu wird ein theoretisches Modell entwickelt, das die einzelnen Schritte, die zur Revision des Handelssystems gef��hrt haben, erkl?ren kann. Dabei werden mit Hilfe von gro?en Energieunternehmen in Deutschland, Gro?britannien und Frankreich die zentralen Akteure dieser Entwicklung identifiziert und ihr Zusammenspiel mit den politischen Akteuren offengelegt. Konkret wird dabei die Entwicklung zwischen den ersten gescheiterten Versuchen der EU Anfang der 1990er, ein Instrument zur Reduktion von Treibhausgasen einzuf��hren, bis zu den ersten beiden Jahren der dritten Handelsphase (2013/ 2014) ber��cksichtigt.
Zugriff auf den Volltext:
https://doi.org/10.20378/irbo-49251
Bilanzielle Aspekte der Betriebsverpachtung : unter besonderer Ber��cksichtigung der Vertragspraxis / von Armin Friedrich
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2017
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 31)
978-3-86309-505-5
Preis: 22,50 �
Die Arbeit befasst sich mit den grundlegenden Bilanzierungsfragen bei Betriebsverpachtungen. Ausgehend von den in der Vertragspraxis anzutreffenden Regelungen erfolgt eine systematische Ableitung aller relevanten Regelungsvarianten. F��r diese werden im weiteren Fortgang die jeweils zutreffende bilanzielle Abbildung abgleitet und auf ?bereinstimmung mit der Behandlung in Literatur und Rechtsprechung gepr��ft.
Zugriff auf den Volltext:
https://doi.org/10.20378/irbo-49494
Die Diffusion von Verwaltungsreformen : Eine Analyse der Reform des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens aus neoinstitutionalistischer Perspektive / von Doris B?hme
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2017
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 30)
978-3-86309-475-1
Preis: 26,00 �
Als klassische neoinstitutionalistische Diffusionsstudie hat die vorliegende Arbeit die ?bersetzung von Umweltvorgaben in Organisationsstrukturen und damit den einhergehender Organisationswandel mit quantitativen Methoden und multivariaten Analysemethoden untersucht. Im Zentrum stand die Frage nach den Einflussfaktoren f��r die Adoption einer Innovation �C insbesondere einer Verwaltungsreform �C um damit die Diffusion dieses Elements und den daraus folgenden organisationalen Wandel erkl?ren zu k?nnen. Der theoretischen Argumentation von DiMaggio und Powell 1983 folgend kann die Verbreitung von Innovationen, welche im Ergebnis zur Homogenisierung organisationaler Felder f��hrt, mit den Mechanismen Zwang, Unsicherheit und normativer Druck erkl?rt werden. Die ?berpr��fung dieser Mechanismen erfolgte anhand der Analyse der Verbreitung der Reform des Haushalts- und Rechnungswesens (HRW) auf der Kommunalebene. Die Untersuchungsperspektive richtete sich besonders auf das organisationale Feld und auf die am Diffusionsprozess beteiligten Akteure. Damit ist die vorliegende Untersuchung anschlussf?hig an die verwaltungswissenschaftliche Organisationsforschung und tr?gt zur Weiterentwicklung des Neoinstitutionalismus und der Diffusionsforschung bei.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-496680
Die ?bertragbarkeit lokaler L?sungsmechanismen auf Bereitstellungsprobleme globaler ?ffentlicher G��ter / von Carolin Stange
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2019
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 29)
978-3-86309-469-0
Preis: 22,00 �
?ffentliche G��ter, z.B. Landesverteidigung, Verkehrsinfrastruktur oder Stra?enbeleuchtung sind G��ter, von dessen Nutzung niemand ausgeschlossen werden kann. Da in derartigen Situationen ��bliche Marktanreize zur G��terproduktion nicht greifen, werden nationale ?ffentliche G��ter meist ��ber den Staat bereitgestellt. Aber auch andere Wege zur Bereitstellung ?ffentlicher G��ter sind grunds?tzlich, wenn auch nicht in allen F?llen, denkbar, z.B. Institutionen oder soziale Normen. In der heutigen Zeit wachsender Globalisierung und Vernetzung der Welt gibt es jedoch immer mehr G��ter, die auch staatlich bzw. national begrenzt nicht bereitstellbar sind, allen voran der Klima- und Umweltschutz auf allen Ebenen, von einem Stopp der Verschmutzung der Meere ��ber einen Erhalt der Artenvielfalt bis zur Einhaltung des Zwei-Grad-Zieles. Aber auch die globale Eind?mmung von ansteckenden Krankheiten, Friedenssicherung oder stabile Finanzm?rkte geh?ren in diese Kategorie. Das zentrale Problem globaler ?ffentlicher G��ter ist jedoch: Die Funktion, die bei nationalen G��tern der Staat einnimmt, ist auf globaler Ebene institutionell nicht vorhanden. Dies w?re z.B. eine Art Weltregierung mit Durchsetzungsgewalt. Mangels einer solchen Instanz muss Kooperation zur L?sung globaler Probleme daher immer im Kern auf freiwilliger Basis erfolgen. Diese hat sich jedoch bislang in den gro?en Problemen unserer Zeit selten eingestellt. Diese Arbeit stellt die grundlegenden Problematiken der Bereitstellung ?ffentlicher G��ter zusammen und untersucht, inwiefern auch alternative Bereitstellungsmechanismen unterhalb der Ebene des Staates bzw. Weltstaates potentiell in der Lage sein k?nnen, Bedingungen f��r Kooperation zu schaffen.
Zugriff auf den Volltext:
https://doi.org/10.20378/irbo-48663
Die Ansiedlung von Aufgaben in der Aufbauorganisation deutscher Landesministerialverwaltungen : Eine handlungstheoretische Erkl?rung von Organisationsentscheidungen ��ber aufbauorganisatorische Arrangements am Beispiel der Migrations- und Integrationspolitik / von Daniel Schamburek
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2016
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 28)
978-3-86309-454-6
Preis: 29,00 �
Das Kernanliegen dieser Arbeit besteht darin, zu ergr��nden, wie Politikfelder in der Aufbaustruktur von Ministerialverwaltungen angesiedelt werden. Diesem Ziel folgend werden vier zentrale Erkenntnisbausteine gewonnen. Der erste Baustein ist deskripti-ver Natur: Am Beispiel der Migrations- und Integrationspolitik wird gezeigt, dass sich die organisatorische Ansiedlung von Politikfeldern in Landesministerialverwaltungen ��ber Zeit und Bundesl?nder hinweg stark unterscheidet. Dies zeigt die empirische Aufarbeitung von Aufbaustrukturen in insgesamt sechs Bundesl?ndern (Baden-W��rttemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen) ��ber einen Zeitraum von 15 Jahren mittels einer detailtiefen Formalstrukturanalyse. Es dr?ngt sich die Frage auf, wie sich die gefundene Varianz erkl?ren l?sst. Zur Beant-wortung dieser Frage wird ein theoretisches Argument herausgearbeitet, welches den zweiten Erkenntnisbaustein darstellt. Das theoretische Argument stellt der Komplexit?t von Aufbauorganisationen einen Wirkmechanismus gegen��ber, der mit wenigen Fak-toren das Zustandekommen organisatorischer Arrangements erkl?ren kann. Damit unterscheidet sich das Argument von herk?mmlichen Erkl?rungsversuchen in diesem Bereich, die oft auf sehr umst?ndliche Theoriemodelle setzen. Der Wirkmechanismus zeigt auf, dass die Ansiedlung von Politikfeldern in komplexen Aufbauorganisationen im Wesentlichen a) vom Interesse des Akteurs am Politikfeld, b) von der Zielrichtung, die vom jeweiligen Akteur verfolgt wird, und c) von den institutionellen Rahmenbedin-gungen, in denen die beteiligten Akteure handeln, abh?ngt. Einige Vers?umnisse der Politikwissenschaft insbesondere bei der theoretischen Mikrofundierung von Salienz-basierten Konzepten in komplexen Auswahlsituationen machen es dabei notwendig, einige Modifikationen am bisherigen Forschungsstand vorzunehmen. Der empirische Test bringt sodann die beiden verbleibenden Erkenntnisbausteine her-vor. Zun?chst f?rdert dieser Test Erkenntnisse zu politischen Positionen der ma?geb-lichen Akteure in sechs Bundesl?ndern ��ber einen Zeitraum von 15 Jahren zutage, die sich gut untereinander vergleichen lassen. Die Bestimmung von Akteurspositionen erfolgt dabei vorwiegend ��ber prim?rdatenbasierte Textanalysen und die Auswertung zahlreicher Interviews. Zudem plausibilisiert der empirische Test das herausgearbeite-te theoretische Argument und verdeutlicht den ?Primat der Politik�� bei der Ansiedlung politikfeldspezifischer Aufgaben in der Aufbaustruktur von Landesministerialverwaltungen.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-479218
Der Diskurs der deutschen Bundesregierung ��ber Unternehmensverantwortung 1991�C2013 : Freiheit in Verantwortung? / von Johanna Horzetzky
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2016
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 27)
978-3-86309-448-5
Preis: 21,00 �
Corporate Social Responsibility (CSR) wird heute in Deutschland auch im politischen Raum als Begriff verwendet, um an Unternehmen gerichtete Erwartungen hinsichtlich verantwortungsvollen Verhaltens zu formulieren. Unternehmensverantwortung in ihren vielf?ltigen Facetten hat jedoch in Deutschland �C unabh?ngig von diesem Begriff �C eine lange Tradition. In der Wissenschaft wird kontrovers diskutiert, ob die relativ neue Bezeichnung auch f��r eine ver?nderte Erwartung von Politik und Gesellschaft an Unternehmensverantwortung steht. Diese Frage ist nicht nur f��r den politischen sondern auch f��r den wirtschaftsinternen Diskurs von Interesse. Denn Legitimit?t wird Unternehmen nur dann zugesprochen, wenn sie den Erwartungen gerecht werden, die aus Politik und Gesellschaft an sie gerichtet werden. Die Haltung der Bundesregierung ist dabei von besonderer Bedeutung. Denn sie kann einerseits gesellschaftliche Erwartungen an Unternehmen beeinflussen. Andererseits kann sie bei einem Verlust von Legitimit?t Unternehmen rechtlich bindende Vorgaben machen. Es stellt sich also die Frage, ob aus der Verwendung des Begriffs CSR durch die Bundesregierung eine ver?nderte Erwartungshaltung gegen��ber Unternehmen abgeleitet werden kann. Dieser Frage wird in einer auf der Wissenssoziologischen Diskursanalyse und der institutionellen Logik-Perspektive aufbauenden Analyse von Redemanuskripten aus dem Bundeskanzleramt der Jahre 1991 bis 2013 nachgegangen. Ergebnis dieser Analyse ist die Erkenntnis, dass die Ver?nderung eher gradueller Natur ist und einer zunehmenden Verantwortungszuschreibung der Bundesregierung an Unternehmen entstammt. Die Bundesregierung misst jedoch in dem untersuchten Zeitraum dem Fortbestand von Unternehmen eine grundlegende Bedeutung zu. Die eigene Aufgabe sieht sie darin, langfristig die Ziele Unternehmensverantwortung und Wirtschaftlichkeit am Standort Deutschland in ?bereinstimmung zu bringen. F��r Unternehmen ergibt sich daraus die Erkenntnis, dass die Zuschreibung von Verantwortung durch die Bundesregierung auch davon abh?ngt, ob die Regierung wirtschaftlichen Handlungsspielraum f��r Unternehmen in dem relevanten Bereich sieht. Auf die Wahrnehmung eines wirtschaftlichen Handlungsspielraums k?nnen Unternehmen in gesellschaftlichen Diskursen jedoch Einfluss nehmen. Auf diese Weise ist verantwortungsvolles Unternehmenshandeln nicht nur als Reaktion auf externe Verantwortungszuschreibung zu sehen. Sondern diese Verantwortungszuschreibung und damit letztlich auch der Inhalt von an sie gerichteten Erwartungen k?nnen von Unternehmen aktiv beeinflusst werden.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-481195
Unternehmens��berwachung in der Europ?ischen Aktiengesellschaft (SE) : Gestaltungsm?glichkeiten und Leistungsf?higkeit des ?berwachungsorgans / von Markus Moelgen
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2016
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 26)
978-3-86309-437-9
Preis: 24,00 �
Die ?berwachungspraxis des Aufsichtsrats der deutschen Aktiengesellschaft ist wiederholt sowohl im Hinblick auf ihre organrechtliche Verfasstheit als auch auf ihre personelle Zusammensetzung und Arbeitsweise kritisch hinterfragt worden. Wiederkehrende Diskussionspunkte betreffen vor allem die mangelnde Gestaltungsfreiheit des deutschen Gesellschaftsrechts im Hinblick auf die Wahl des Leitungssystems, die Gr??e des ?berwachungsorgans sowie die Auswirkungen der Mitbestimmung auf Entscheidungsprozesse und personelle Zusammensetzung. Mit der Europ?ischen Aktiengesellschaft (SE) hat der europ?ische Gesetzgeber zum 8. Oktober 2004 eine Rechtsform eingef��hrt, die den Anspruch erhebt, f��r grenz��berschreitende Belange im europ?ischen Binnenmarkt ein effizienteres und sachgerechteres B��ndel spezifischer Rechtsnormen zu bieten. Die SE bietet in Deutschland ans?ssigen Unternehmen erstmals die M?glichkeit, in einer Aktiengesellschaft zwischen einem System aus Vorstand und Aufsichtsrat oder einem Verwaltungsrat zu w?hlen, die Organgr??e unternehmensindividuell anzupassen sowie Arbeitnehmervertreter aus verschiedenen europ?ischen Mitgliedsstaaten in das Aufsichtsorgan zu integrieren. Ziel der Untersuchung ist es, der Frage nachzugehen, inwiefern die SE neue Gestaltungsoptionen f��r die Unternehmens��berwachung er?ffnet und welche Auswirkungen von der Nutzung dieser Optionen auf die ?berwachungspraxis ausgehen.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-475508
Die Anerkennung der Europ?ischen Union in internationalen Kooperationsprojekten / von Marc M��hleck
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2016
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 25)
978-3-86309-427-0
Preis: 19,50 �
Der Europ?ischen Union (EU) gelingt es zunehmend, in dem um Staaten zentrierten internationalen System als eigenst?ndiger Akteur anerkannt zu werden. Sie beansprucht damit eine herausgehobene Rolle im Vergleich zu anderen nichtstaatlichen Akteuren und tritt neben oder gar an die Stelle ihrer eigenen Mitgliedsstaaten. Es stellt sich die Frage, wann und warum die EU in einem internationalen Kooperationsprojekt eine solche Anerkennung erf?hrt. Die vorherrschenden Ans?tze der EU- und IGO-Forschung bieten keinen geeigneten Rahmen f��r diese Frage. Daher wird ein neuer Ansatz auf der Basis von James Colemans korporativen Akteur, seinem Modell der Ressourcenzusammenlegung und systemtheoretisch-inspirierten Autonomie��berlegungen entwickelt. Eine Anerkennung der EU f��r ein Kooperationsprojekt wird auf der Basis von Relevanz, welche sich aus interner Handlungsf?higkeit ergibt, erkl?rbar. Auf empirischer Seite werden 24 F?lle aus der Ern?hrungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) sowie dem Regime zur Bek?mpfung weitr?umiger grenz��berschreitender Luftverschmutzung (LRTAP) untersucht und auf die Anwendbarkeit und Erkl?rungskraft des Ansatzes gepr��ft. Dabei handelt es sich um alle Subregime im Rahmen der FAO, um das Engagement der Union in der FAO-Organisation selbst sowie um die Konventions- und Protokollverhandlungen des LRTAP-Regimes.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-472121
Regionale Bindung von Familienunternehmern : Konzeption und Einfluss auf Entscheidungsprozesse zur Verlagerung von Arbeitspl?tzen in deutschen und spanischen Familienunternehmen / von Sonia Vilaclara Fatjo
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2016
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 24)
978-3-86309-411-9
Preis: 22,50 �
Eine insbesondere in Deutschland g?ngige Vorstellung ��ber ein typisches Charakteristikum von Familienunternehmen bezieht sich auf eine ihnen unterstellte Verbundenheit mit dem heimischen Standort des Unternehmens, die sowohl auf der Betonung von Traditionen wie auch einem Verantwortungsbewusstsein gegen��ber der Region und dem dort besch?ftigten Personal basiert. Diese regionale Bindung von Familienunternehmern fand als eigenst?ndiges Konstrukt bislang nur wenig Beachtung in der betriebswirtschaftlichen Forschung. Dennoch kann angenommen werden, dass sich eine regionale Bindung von Familienunternehmern auch auf strategische Entscheidungen in diesen Unternehmen auswirkt. Zudem sehen sich im Zuge einer allgemein steigenden internationalen Ausrichtung von Unternehmen auch Familienunternehmen der Notwendigkeit gegen��ber, ihre Wertsch?pfungsketten international zu optimieren. Ausgehend von dieser Forschungsl��cke liefert die Studie eine systematische Erfassung der regionalen Bindung von Familienunternehmern und untersucht diese empirisch im Rahmen von Arbeitsplatz-verlagerungsentscheidungen ins Ausland. Besonderheiten in Familienunternehmen k?nnen mit dem Einfluss von familiensystemischen Eigenschaften auf die Unternehmensf��hrung erkl?rt werden. F��r die l?ndervergleichende Arbeit werden Familienunternehmen aus dem eher individualistischen Deutschland sowie dem vergleichsweise st?rker kollektivistisch gepr?gten Spanien gegen��bergestellt. Auf diese Weise werden auch landeskulturelle Besonderheiten regionaler Bindung von Familienunternehmern untersucht.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-465386
Who retires when and why? : A Comparative Analysis of Retirement Processes on the Case Study Denmark / by Julia Schilling
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2016
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 23)
978-3-86309-401-0
Preis: 21,00 �
The present dissertation traces how trends relating to globalization and demographic change impact on the labor market situation and retirement processes of older workers. The work focuses on Denmark, which is often cited as a role model for other OECD countries due to its specific institutional context and its traditionally high labor market participation of older people. In addition, the results from this Danish country study are compared to findings from Germany and the Netherlands, enabling an assessment of Denmark��s performance from a cross-country comparative perspective. In that context, the empirical analyses combine an examination of observed experiences in both the late career and the retirement process with how people themselves view their transition into the state of retirement.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-462798
Die Proliferation regionaler Integrationsabkommen in S��damerika : Die Entstehung des institutionellen Komplexes und seine Konsequenzen / von Julia Dinkel
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2016
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 22)
978-3-86309-403-4
Preis: 21,00 �
Seit mehr als f��nf Jahrzehnten sind intensive Bem��hungen seitens der s��damerikanischen Staaten zu beobachten, regionale Institutionen f��r eine verst?rkte Zusammenarbeit und Integration in S��damerika zu etablieren. So besteht auf dem s��damerikanischen Kontinent seit 1969 die Andengemeinschaft (Comunidad Andina de Naciones, CAN), seit 1980 die Lateinamerikanische Integrationsvereinigung (Asociaci��n Latinoamericana de Integraci��n, ALADI), seit 1991 der Gemeinsamen Markt des S��dens (Mercado Com��n del Sur, Mercosur), seit 2005 die Bolivarianische Allianz f��r die V?lker unseres Amerika (Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra Am��rica, ALBA), seit 2008 die Union S��damerikanischer Nationen (Uni��n de Naciones Suramericanas, UNASUR) und schlie?lich seit 2012 die Pazifische Allianz (Alianza del Pac��fico). Diese Institutionen formen ein Netz an Institutionen, das im Verlauf der vorliegenden Arbeit als institutioneller Komplex zur regionalen Integration in S��damerika bezeichnet wird. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die Entstehung dieses institutionellen Komplexes zur regionalen Integration in S��damerika und den sich ergebenden Konsequenzen theoretisch und empirisch zu untersuchen. Das Modell zur Erkl?rung der institutionellen Komplexe in S��damerika wird auf der Grundlage der Forschung zu institutionellen Komplexen entwickelt. Zur Untersuchung der Konsequenzen, die sich aus der Entstehung des institutionellen Komplexes ergeben haben, wird auf kausale Mechanismen aus der Forschung zur Wechselwirkung von Institutionen und auf Argumente aus der Organisations?kologie zur��ckgegriffen. Dazu wird mittels qualitativer Fallstudien und der Methode der Prozessanalyse untersucht, wie die Performanz der bestehenden Institutionen einen Einfluss auf die Entstehung des institutionellen Komplexes entwickeln konnte und welche Konsequenzen sich hieraus ergeben haben.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-462581
Innovation landscape in developed and developing markets : A conceptual and empirical study on technology convergence and low cost innovations / von Nivedita Agarwal
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2016
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 21)
978-3-86309-397-6
Preis: 18,00 �
Innovation is proven to be an absolute requirement for growth in both developed and developing countries, but the type and motivation of innovations differ depending on various surrounding factors. In developed countries innovations are often technology-driven and associated with delighting the end customers. On the contrary, in the emerging markets; due to the unique settings and infrastructural gaps innovations are focused towards meeting customer��s fundamental needs. Considering these vast differences, this research focuses on the comparison of the on-going innovation fostering in both developed and developing world individually.
In developed world, where information technology (IT) is emerging out as the key enabling technology, thesis focuses on technology convergence and IT enabled business transformations. It illustrates the case of General electric and describes its Industrial Internet initiative.
On emerging markets side, thesis discusses various types of innovation approaches adopted by local firms and multi-national companies to develop bottom-up low-cost products. It attempts to consolidate the research insights into a unified framework. It also touches upon the topic of social enterprises as a medium to diffuse social innovations into emerging markets to address social challenges and developmental issues like poverty and access to healthcare services.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-462569
Enterprise Resource Planning Systeme im kaufm?nnischen Unterricht / von Clemens Fr?tschl
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2015
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 20)
978-3-86309-363-1
Preis: 20,00 �
In einer Zeit, in der Enterprise Resource Planning Systeme einerseits in nahezu allen Industrie- und Handelsbetrieben genutzt werden und auf der anderen Seite von kaufm?nnischen Auszubildenden anwendbares Wissen ��ber betriebliche Abl?ufe und Zusammenh?nge gefordert wird, kann Lernenden im schulischen Umfeld durch den Einsatz von integrierter Unternehmenssoftware eine realit?tsnahe Lernumgebung verf��gbar gemacht werden, die aktuelle Anforderungen an kaufm?nnische Sachbearbeiter aufgreift und im Unterricht erfahrbar macht. Der Unterrichtseinsatz von ERP-Systemen ist aber an diverse Bedingungen gekn��pft, die Lehrpersonal und Lernende vor besondere Herausforderungen stellen. Die vorliegende Arbeit versucht einen Beitrag zur Einf��hrung ERP-Systemen in den kaufm?nnischen Unterricht an Berufsschulen zu leisten. Dabei werden die angesprochenen Bedingungen aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet und bei der anschlie?enden Gestaltung eines prototypischen Unterrichtsarrangements zur Einf��hrung in die Arbeit mit integrierter Unternehmenssoftware ber��cksichtigt. Das Unterrichtsarrangement wird nach mehreren Praxisl?ufen empirisch untersucht, um seine Eignung, einen einfachen Einstieg in die Arbeit mit integrierter Unternehmenssoftware zu erm?glichen, zu ��berpr��fen.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-449673
Strategische Fr��haufkl?rung und der Einfluss auf die Innovationsf?higkeit : Eine Fallstudienanalyse / von Jacqueline Kundt
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2014
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 19)
978-3-86309-250-4
Preis: 21,50 �
Die Innovationsf?higkeit von Unternehmen stellt einen zentralen Erfolgsfaktor dar, die vor allem durch das fr��hzeitige Aufsp��ren und Nutzen von Innovationspotential gepr?gt ist. Nichtsdestotrotz erschweren zunehmende Komplexit?t und Dynamik des Unternehmensumfeldes ein rechtzeitiges Agieren. Bekannte Unternehmensbeispiele wie Nokia und Kodak zeigen, dass Unternehmen h?ufig Produktwandel und damit neue Anforderungen an Innovationen verschlafen. Vor diesem Hintergrund wird die Nutzung einer strategischen Fr��haufkl?rung diskutiert, die fr��hzeitig Trends und Entwicklungen aus dem Unternehmensumfeld identifiziert und geeignete Ma?nahmen ableitet und damit auch in der Lage ist, die Innovationsf?higkeit von Unternehmen zu verbessern. Trotz der hohen wissenschaftlichen und praktischen Relevanz ist es bisher nicht gelungen, den Einfluss einer strategischen Fr��haufkl?rung auf die Innovationsf?higkeit wissenschaftlich zu fundieren, um diesen Zusammenhang abschlie?end zu bewerten. Diese Forschungsl��cke wird anhand einer multiplen Fallstudienuntersuchung in internationalen Unternehmen geschlossen. Indem alle relevanten Entscheidungstr?ger im Prozess befragt werden, wird der Wirkungsmechanismus auf die Innovationsf?higkeit identifiziert und analysiert. Dar��ber hinaus werden Faktoren identifiziert, die ein Wirken der strategischen Fr��haufkl?rung erm?glichen und verbessern. Im Ergebnis entsteht ein umfassendes Bild ��ber das Wirken der Fr��haufkl?rung und dessen Anwendung im Innovationsmanagement.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-104602
Hochschulreformen in Deutschland : Hochschulen zwischen staatlicher Steuerung und Wettbewerb / von Ruth Kamm
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2014
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 18)
ISBN 978-3-86309-248-1
Preis: 20,00 �
Wettbewerb hat in der j��ngeren Vergangenheit im Zusammenhang mit Reformbem��hungen im deutschen Hochschulwesen hohe Aufmerksamkeit erfahren. Er ist mittlerweile in vielf?ltigen Auspr?gungen Teil der Koordinations- und Steuerungsprozesse im deutschen Hochschulsystem und aus der Vielfalt der etablierten Governance-Instrumente nicht mehr wegzudenken. Trotzdem resultiert aus dieser Entwicklung keineswegs eine Abkehr von der grundlegenden staatlichen Verantwortung f��r das Hochschulwesen. Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Arbeit die Bandbreite beobachteter Wettbewerbsph?nomene theoretisch fundiert erfasst und hinsichtlich der Folgen f��r Aus��bung von Koordination und Steuerung im deutschen Hochschulsystem bewertet. Mithilfe eines daf��r entwickelten analytischen Rahmens, der politik- und governance-theoretische Elemente verbindet, werden etablierte und neue Wettbewerbsinstrumente in ihrer je spezifischen Funktionsweise erfasst und voneinander abgegrenzt. Dabei wird neben der nationalen Konfiguration auch die Einbettung in den europ?ischen und internationalen Kontext ber��cksichtigt. Auf diese Weise wird ein umfassendes Bild der Rolle von Wettbewerb im Gesamtkontext bestehender Governance-Instrumente gezeichnet und aufgezeigt, inwiefern Wettbewerbsinstrumente bewusst zur Steuerung und Koordination in Hochschulsystemen eingesetzt werden k?nnen.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-102131
Interkulturalisationsprozesse in multikulturellen Kreativteams : Theoretische Konzeption und empirische ?berpr��fung / Carolin Fleischmann
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2014
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 17)
978-3-86309-237-5
Preis: 21,00 �
Aufgrund des europ?ischen Binnenmarktes und zunehmender globaler wirtschaftlicher Vernetzung sind Unternehmen mit einer multikulturellen Belegschaft konfrontiert. Der Austausch zwischen unterschiedlich kulturell gepr?gten Mitarbeitern findet in sogenannten kulturellen ?berschneidungssituationen statt. Dabei wird die eigene Lebenswelt infrage gestellt, indem das Individuum mit divergierenden Orientierungssystemen und Interpretationsmustern konfrontiert wird. Dies kann zu einem breiten Spektrum an L?sungsans?tzen jedoch ebenso zu dysfunktionaler Kommunikation und Konflikt f��hren. Es herrscht bislang keine Einigkeit dar��ber, ob positive oder negative Auswirkungen der Multikulturalit?t die Zusammenarbeit dominieren und welche Teamprozesse durch Multikulturalit?t ��berhaupt angesto?en werden. Kulturelle ?berschneidungssituationen sind aus der Unternehmenspraxis nicht mehr wegzudenken: Sie entstehen beim Transfer von Managementkapazit?ten, im Rahmen von Mergers & Acquisitions sowie bei der Zusammenarbeit multikulturell besetzter Teams. Um die Bearbeitung komplexer Aufgaben zielf��hrend zu gestalten, greifen Unternehmen zunehmend auf multikulturelle Teams zur��ck. Dies gilt insbesondere f��r die Erarbeitung innovativer L?sungen. Kreativit?t nimmt dabei als Basis f��r Innovation eine bedeutende Rolle ein. Die Interaktion von Mitgliedern multikultureller Teams sowie die Herausbildung einer neuen Kultur im Sinne einer ?Interkultur�� haben bislang in der betriebswirtschaftlichen Forschung kaum Beachtung gefunden. Diese Studie setzt sich mit der empirischen ?berpr��fung und Integration der fragmentierten konzeptionellen Ans?tze zur Interkulturalisation auseinander.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-100834
Ursachen und Erfolgswirkung der Interaktionsstrukturen in Unternehmenskooperationen : Eine Untersuchung am Beispiel internationaler Forschungs- und Entwicklungskooperationen / von Dieter Dresel
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2014
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 16)
ISBN 978-3-86309-235-1
Preis: 26,00 �
Strategische Allianzen und insbesondere Forschungs- und Entwicklungskooperationen stellen f��r Unternehmen ein verbreitetes Instrument zur Sicherstellung der Wettbewerbsf?higkeit dar, erweisen sich f��r beteiligte Organisationen jedoch h?ufig als wenig erfolgreich. Ein wesentlicher Grund hierf��r besteht in der Schwierigkeit diese institutionellen Arrangements so zu gestalten, dass das wechselseitig interdependente Verhalten der Partner dauerhaft einen kooperativen Charakter aufweist. Die Ursachen sowie die Erfolgswirkung und die Varianz m?glicher Auspr?gungen wechselseitigen Verhaltens sind dabei bislang weitestgehend unerforscht. Vor diesem Hintergrund besteht die grunds?tzliche Zielsetzung der Arbeit darin, das Spektrum m?glicher Strukturen wechselseitiger Handlungen in Kooperationen zu identifizieren sowie die Zusammenh?nge zwischen diesen Interaktionsstrukturen, den Handlungsursachen und dem Kooperationserfolg der Teilnehmer am Beispiel internationaler Forschungs- und Entwicklungskooperationen theoretisch und empirisch zu untersuchen. Hierzu wird zun?chst eine Meta-Analyse erfolgsrelevanter Faktoren in Forschungs- und Entwicklungskooperationen durchgef��hrt. Daran anschlie?end entwickelt die Arbeit ein die Interaktion der Kooperationsteilnehmer explizit ber��cksichtigendes handlungstheoretisches Modell. Dieses bestimmt das Spektrum m?glicher Interaktionsstrukturen und setzt diese kausaltheoretisch sowohl zu Konfigurationen relevanter Erfolgseinfl��sse als auch zum Erfolg der Kooperationsteilnehmer in Beziehung. Die empirische Analyse der resultierenden Hypothesen erfolgt auf Grundlage eines Querschnittssamples von 471 Organisationen aus 359 internationalen Forschungs- und Entwicklungskooperationen der Forschungsf?rderungsprogramme ?Eureka�� und ?Eurostars��. Die Testresultate der linearen, hierarchischen Regression st��tzen generell die modelltheoretischen Vorhersagen.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-100582
Survey-Based Study on Partial Aspects of Retirement Decisions of Private Persons in Germany / Ivonne Honekamp
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2014
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 15)
ISBN 978-3-86309-229-0
Preis: 20,00 �
In Germany, private retirement provision is a topic of increasing importance. The ageing population in combination with unemployment, an increasing number of temporary work contracts, more individuals who work part-time or in jobs not subject to social insurance contributions, make it problematic to finance the pensions of the retired in a pay-as-you-go financed pension system. Besides, the number of individuals not able to acquire sufficient pension claims exceeding the needs-oriented basic pension is increasing. Several pension reforms have taken place in order to alleviate the pressure on the pay-as-you-go system. In 2001, a voluntarily funded part was introduced to close the pension gap which has slowly been rising due to a declining replacement rate in the statutory pension system. Individuals now have to decide if they start to provide for retirement privately, how much they are going to save and where to invest. Such decisions require a sound knowledge of the German pension system and general financial knowledge in order to be able to approximate retirement needs and to compare financial products. Based on the theory of saving and its behavioral refinements, a decision model has been developed in this thesis which describes each step from thinking about retirement to actually saving for retirement. Each of these steps has been investigated empirically in order to find out more about the hurdles individuals face on their way towards private retirement savings. Based on an instrumental variable estimation, it will be shown that providing information about retirement provision alone will not be sufficient to make people think about an appropriate retirement income, to induce people to make concrete retirement plans and to increase the number of individuals who translate their plans into action. Instead of providing general pension knowledge, offering concrete and targeted information at the time it is needed might be a more successful strategy. These idea, results and conclusions stem from Oehler and Wilhelm-Oehler 2009a, 2011 who analyze the data from ?Altersvorsorge macht Schule�� (?retirement planning goes school��). They recommend a practice-oriented, case-based financial education as well as a ?meta education�� to improve the ?meta literacy�� as shown by Oehler (2004, 2009a, 2011, 2012a, 2012d-e, 2013a-b). ?Meta literacy�� in this sense means that it is more important to know methods or people who can solve the problem when it appears, than acquiring all knowledge themselves being prepared to solve all possible problems (Oehler/Wilhelm-Oehler 2009, 2011; Oehler 2011, 2012a, 2012d-e, 2013a-b). This strategy may also be successful to solve the problem of time constraints which many individuals stated to be the main reason why they would not participate in a retirement seminar. Furthermore, the confidence in one��s own knowledge seems to be more important than actual knowledge which requires measures to increase consumer confidence. Such a measure could be, for example, a hypothetical situation in which seminar participants have to evaluate the offer they received from a financial advisor (Oehler 2004, 2005b, 2006, 2011, 2012a, 2012d-e, 2013a-b). According to the literature findings in the last five decades it is known that individuals fall back to heuristics in order to simplify decision. This behavior has also been observed in this work. Even though they own a pension product, they stated they did not try to figure out how much retirement wealth would be necessary to live an adequate retirement life. Hence, they must have followed some kind of decision rule to decide, among others, about the amount they save. Using heuristics was more prevalent among individuals owning a ��Riester Pension�� than among individuals owning a company pension. Since individuals with a company pension often receive information about the pension plan through the employer or via employer sponsored retirement seminars, such seminars seem likely to have the potential of increasing the number of individuals who engage in retirement planning before starting to save. The second one is that individuals who admit that they tend to procrastinate on financial decisions are more likely to join a retirement seminar than individuals who indicate that they would rather not procrastinate. Making people aware of the widespread problem of procrastinating retirement savings might increase the number of individuals who realize that they have procrastinated retirement planning and henceforth increase the number of individuals participating in retirement seminars.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-69425
Der ?bergang in die Sekundarstufe I: Die Bedeutung sozialer Beziehungen f��r den Schulerfolg und die Formation elterlicher Bildungsentscheidungen / von Lydia Kleine
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2014
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 14)
ISBN 978-3-86309-220-7
Preis: 16,00 �
Einer der wichtigsten Bildungs��berg?nge im deutschen Schulsystem ist der von der Primar- in die Sekundarstufe, da hier Weichen f��r den gesamten weiteren Bildungsverlauf gestellt werden. Die Dissertation widmet sich diesem Thema anhand der Fragen nach der Bedeutung sozialer Beziehungen f��r den Schulerfolg sowie der Genese der elterlichen Bildungsentscheidung f��r eine Schulform der Sekundarstufe I. Die empirischen Analysen basieren auf Grundschuldaten des zweiten L?ngsschnittes der BiKS-Studie 8-14. Als Fazit aller drei empirischen Kapitel l?sst sich festhalten, dass die Ergebnisse f��r die Entwicklung der ��bertrittsrelevanten Noten, des schulischen Selbstkonzeptes sowie der Genese der Bildungsentscheidung insgesamt die Bedeutung sozialer Beziehungen verdeutlichen. Diese schaffen eine Basis f��r die Transmission von Humankapital sowie bildungsf?rderlicher Werte. Mit dem Fischteicheffekt kann auch ein anderer Wirkmechanismus sozialer Beziehungen als bedeutsam identifiziert werden. F��r die Genese der ?bertrittsentscheidung zeichnen sich dar��ber hinaus Kosten- und Nutzenabw?gungen verantwortlich, wie es die Rational Choice Theorien postulieren. Inwiefern eine Kalkulation zu beobachten ist, h?ngt stark an den ?bergangsregeln der Bundesl?nder sowie dem Bildungshintergrund der Eltern.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-68564
Interkulturalisation in multikulturellen Teams : Entwicklung eines theoriegeleiteten und empirisch gest��tzten Analysekonzeptes
/ Laura-Christiane Folter
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2014
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 13)
ISBN 978-3-86309-202-3
Preis: 21,00 �
Kulturelle ?berschneidungssituationen sind ein fester Bestandteil der Unternehmenspraxis geworden, ob beim Transfer von Managementkapazit?ten im Rahmen des Auslandseinsatzes von F��hrungskr?ften, bei der Arbeit in multikulturellen Teams oder im Zusammenhang mit internationalen Verhandlungen. Eine wesentliche Herausforderung der Unternehmen besteht dabei im Verbinden differierender Werte, Normen und Verhaltensweisen der verschieden kulturell gepr?gten Teammitglieder. Im Falle der Herausbildung einer ?neuen Kultur�� als Ergebnis kultureller ?berschneidungssituationen ist unter anderem von der Entstehung einer ?Interkultur�� die Rede. Interkultur ist das Resultat eines Prozesses im ?Dazwischen�� von Kulturen, der durch Interaktion und Reflexion eigen- und fremdkultureller Verhaltensweisen gegenseitige Anerkennung und eine gemeinsame Teamidentit?t stiftet und durch Kreation eines dritten, neuen innovativen Orientierungssystems zu Synergien f��hren kann. Trotz der hohen wissenschaftlichen Relevanz kultureller ?berschneidungssituationen und deren Resultate, existiert bis dato keine wissenschaftliche Untersuchung zur Existenz und den Folgen einer Interkultur. Um diese Forschungsl��cke zu schlie?en, werden zun?chst multikulturell besetzte Studententeams in einer L?ngsschnittstudie mit Hilfe eines problemzentrierten, halbstrukturierten Interviewleitfadens zur Teamarbeit und Teamentwicklung befragt. Die aus dieser Befragung und aus der Literaturanalyse gewonnenen Ergebnisse werden in eine experimentelle Beobachtungsstudie ��berf��hrt. Diese Studie, die ebenfalls mit Studententeams durchgef��hrt wird, ��berpr��ft und erkl?rt die Existenz einer Interkultur, um daraufhin Implikationen zur Handhabung einer Interkultur f��r die unternehmerische Praxis zu generieren.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-69029
Werthaltungen und Ethos von Lehrern : Empirische Studie zu Annahmen ��ber den "guten" Lehrer / von Paul Harder
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2014
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 12)
ISBN 978-3-86309-214-6
Preis: 21,00 �
Die wissenschaftliche Frage nach dem guten Lehrer stellt sich durchaus auch heute noch. Das Problem liegt dabei bei der Definition von gut selbst, das als Platzhalter viele Meinungen und Auffassungen zu seiner semantischen F��llung zul?sst. Eingedenk der Tatsache, dass gut in der zeitgen?ssischen philosophischen Betrachtung im Zuge der Aufkl?rung und S?kularisierung metaphysisch vom summum bonum entkoppelt wurde und somit seinen Anspruch auf allgemeing��ltige Objektivit?t eingeb��?t hat, k?nnen Personen, Dinge oder Handlungen nicht mehr in Ansehung des h?chsten Gutes konnativ mit dem Pr?dikat gut versehen werden. Wenn also nicht das eine Gut gilt, sondern viele Gute (G��ter) ihre Berechtigung anmelden, dann geht es darum, in einem fortw?hrenden Diskurs gesellschaftlich g��ltige Normen auszuloten. Nun wird aber nicht von G��tern gesprochen, wenn es um ein individuelles Pr?ferenzmodell geht, sondern von unterschiedlichen Werten. Somit erfolgt eine Auseinandersetzung mit Werten und Werthaltungen als deren individuell verinnerlichten Entsprechungen. Mit der gesellschaftspolitischen Frage, wof��r die Lehrer zust?ndig sein sollen und wollen, wird auch die Frage nach dem Lehrerethos erneut gestellt. Dabei ist das Wesen von ethos zu bedenken, welches eine individuelle und eine kollektive Komponente enth?lt. Der gew?hnliche Ort des (professionellen) Lebens, den das (Berufs-)Ethos meint, schlie?t neben ethisch-moralischen und p?dagogischen Aspekten auch eine Positionierung zu sozialen, ?konomischen, politischen oder ?sthetisch-religi?sen Fragen der Berufspraxis ein. Mit der Konkretisierung eines Lehrerethos in diversen Konstruktionen und Modellen wird ersichtlich, wie die Ethoskomponenten Gewohnheit, Sitte, Brauch und Charakter operationalisiert werden. Es sind stets Werthaltungen, deren B��ndel als Ethos festgehalten werden. Das (Berufs-)Ethos l?sst sich ergo als Konzentrat von (berufsspezifischen) Werten begreifen, was das Ethos somit f��r das konkrete (professionelle) Handeln als Bestimmungsgrund wertgerichteten Handelns best?tigt. F��r Verh?ltnisse und Vollz��ge des Lehrerethos ergeben sich einige spezifische dimensionale Implikationen. Aus empirischer Sicht wird ein Untersuchungsdesign vorgeschlagen, das es erm?glicht, die tats?chlichen, berufsspezifischen Werthaltungen zu erheben. Ziel der Erhebung sollte dabei nicht sein, Werthaltungen innerhalb vorgefertigter Skalen oder Vorlagen bewerten oder sortieren zu lassen. Mit der Means-End-Theorie und dem Laddering-Ansatz wird es erm?glicht, individuelle Werthaltungen als Mans-End-Ketten aufzudecken und im Zusammenhang mit dem Ethos zu diskutieren.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-66014
Soziale Ungleichheiten beim Verm?gen und Immobilienbesitz : Eine Analyse von Verm?gens- und Wohneigentumsungleichheiten im internationalen, innerdeutschen sowie historischen Vergleich / von Kathrin Kolb
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2013
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 11)
ISBN 978-3-86309-184-2
Preis: 18,50 �
Ziel der vorliegenden Dissertation ist es, Verm?gens- und Wohneigentumsungleichheiten in Ost- und Westdeutschland sowie im europ?ischen Vergleich detailliert zu untersuchen. Die Analyse von Verm?gensungleichheiten mit einem Fokus auf die zentrale Verm?genskomponente Wohneigentum und damit eine Abkehr von der bislang vorherrschenden Fokussierung auf Bildungs- und Arbeitsmarktprozesse erm?glicht ein umfassenderes und multidimensionales Verst?ndnis sozialer Ungleichheitsstrukturen. Durch diese Herangehensweise wird der hohen soziostrukturellen Bedeutung von Verm?gen und Wohneigentum Rechnung gezollt. Im Rahmen der Arbeit wird aus international vergleichender Perspektive die Verm?gens- und Immobiliensituation Deutschlands analysiert. Mit Hilfe umfangreicher empirischer Analysen kann gezeigt werden, dass die einseitige Fokussierung auf Einkommen zu einer Untersch?tzung oder, wie im Falle der skandinavischen L?nder, sogar zu einer falschen Beurteilung von sozialen Ungleichheiten f��hrt. Eine Betrachtung der Verm?genssituation, welche vor allem durch Wohneigentum bestimmt wird, ist daher in der sozialen Ungleichheitsforschung unerl?sslich. Zudem wird die Entwicklung von Wohneigentumsungleichheiten im innerdeutschen Vergleich untersucht. Noch immer bestehen signifikante Unterschiede bei der Wohneigent��merquote zwischen Ost- und Westdeutschland. Bemerkenswert ist jedoch, dass diese Divergenzen f��r die j��ngeren Kohorten beim Zugang zu Wohneigentum nicht festgestellt werden k?nnen. Dieses Ergebnis ist ein Indiz daf��r, dass sich die Wohneigentumssituation zwischen den zwei Landesteilen k��nftig immer mehr ann?hern wird.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-45650
Valuation, Empirical Analysis, and Optimal Exercise of Open-End Turbo Certificates / von Sebastian Paik
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2013
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 10)
ISBN 978-3-86309-178-1
Preis: 21,00 �
This dissertation analyzes Open-End Turbo Certificates (OETCs), a popular class of retail derivatives. OETCs can be exercised at any time at the investor��s discretion. In order to explain the existence of the certificates jump risk must be considered. We propose and implement an optimal stopping approach to price these securities, which further allows for determining optimal exercise thresholds. They result from the trade-off between benefits from downward jump protection and financing costs. We show that early exercise right has a significant impact on their values. In an empirical analysis pertaining to the years 2007 through 2009 it turns out that certificates which could be rationally held are very rare, although the degree by which the underlying exceeds the optimal exercise thresholds continually declines over the considered period. We suggest three lines of explanation: general market movement, jump risk perception by the market, and increased competition among issuers.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-44043
Mechanismen institutioneller Dynamiken : eine vergleichende Prozessanalyse der Entwicklung des ASEAN-Handelsregimes / Axel Obermeier
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2013
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 9)
ISBN 978-3-86309-176-7
Preis: 18,50 �
Die allgemeine Zielsetzung dieser Arbeit besteht darin, die Dynamik internationaler Institutionen theoretisch und empirisch zu untersuchen. Dazu wird in dieser Arbeit ein handlungstheoretisches Argument entwickelt, das strukturinduzierte Interessen und akteursspezifische Ideen als kombinatorische Einflussfaktoren f��r die Pr?ferenzbildung von Staaten hinsichtlich institutioneller Dynamiken konzipiert. Die kausale Logik des Argumentes wird in zwei Mechanismen abgebildet: Der Mechanismus der Pr?ferenz-Destabilisierung enth?lt Aussagen dar��ber, wie Ver?nderungen relevanter Strukturen die Pr?ferenz eines Staates hinsichtlich einer Institution beeinflussen. Mit dem Mechanismus der Pr?ferenz-Delegitimierung wird hingegen plausibilisiert, wie Ver?nderungen von Ideen die Pr?ferenz eines Staates hinsichtlich einer Institution beeinflussen. Schlie?lich wird von der kombinatorischen Wirkung dieser Mechanismen auf die Auspr?gung institutioneller Dynamiken geschlossen, die Staaten anstreben. In der empirischen Analyse wird die Entwicklung des ASEAN-Handelsregimes seit seiner Gr��ndung 1977 untersucht. Dazu wird in einer Kombination aus qualitativem Fallvergleich und Prozessanalyse analysiert, welche Variablen kausalen Einfluss haben und ob die Mechanismen entsprechend der formulierten Annahmen wirken.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-43802
Analyse von Einkommensverteilungen : Ans?tze, Methoden und Empirie / von Johannes Schwarze und Susanne Elsas
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2013
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 8)
ISBN 978-3-86309-158-3
Preis: 27,00 �
Das vorliegende Lehrbuch behandelt die Analyse der personellen Einkommensverteilung aus wohlfahrts?konomischer Perspektive. Es stellt einerseits wichtige Ungleichheitsma?e und Methoden der graphischen Darstellungen vor, die zur Charakterisierung der personellen Einkommensverteilung in Wissenschaft und Politik verwendet werden. Dabei werden systematisch die Eigenschaften und auch Zusammenh?nge der verschiedenen Ma?e thematisiert. Andererseits werden Konzepte und Methoden der Erhebung von Einkommen vorgestellt, und vor dem Hintergrund diskutiert, aus der Verteilung der personellen Einkommen m?glichst valide Aussagen ��ber die Verteilung der individuellen Wohlfahrt in einer Gesellschaft abzuleiten. Das Lehrbuch bietet einen fundierten und kritischen Zugang zur Einkommensverteilungsanalyse, sowohl f��r Studierende der Sozialwissenschaften, als auch f��r Interessierte und Engagierte in Beratung und Politik.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-35944
Fehlende Werte in den Sozialwissenschaften : Analyse und Korrektur mit Beispielen aus dem ALLBUS / Martin Messingschlager
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2012
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 7)
ISBN 978-3-86309-122-4
Preis: 27,00 �
Fehlende Werte bilden seit jeher eine gro?e methodische Herausforderung f��r quantitative Analysen in den Sozialwissenschaften. Die Methodenforschung deutet darauf hin, dass sich in einigen Bereichen das Problem fehlender Werte noch versch?rfen wird. In dieser Arbeit werden zun?chst die wichtigsten Theorien zu Item und Unit Nonresponse zusammengefasst. Anhand von Beispielen aus dem ALLBUS werden anschlie?end Analysen zu Item und Unit Nonresponse vorgenommen. Im Weiteren werden Korrekturmethoden f��r fehlende Werte durch ein auf realen Daten basierendes neues Verfahren verglichen. Dabei steht im Zentrum des Methodenvergleichs das Abschneiden der Multiplen Imputation als Korrekturmethode. Die Ergebnisse sprechen bei Item Nonreponse klar f��r die Anwendung der Multiplen Imputation vor allem bei multivariaten Analysen. Obwohl die Ergebnisse f��r Unit Nonresponse keine klaren Empfehlungen zulassen, erscheint der Weg, Multiple Imputation auch dort zu verwenden, bei g��nstiger Datenlage als Alternative zu Gewichtungen.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-16185
EU-Agrar- und Regionalpolitik : wie vergangene Entscheidungen zuk��nftige Entwicklungen beeinflussen ; Pfadabh?ngigkeit und die Reformf?higkeit von Politikfeldern / von Thomas Geppert
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2012
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 6)
ISBN 978-3-86309-082-1
Preis: 19,50 �
In der Dissertation wird die Reformf?higkeit der EU-Agrarpolitik und der EU-Regionalpolitik vergleichend analysiert. Die Analyse wird dabei von der Theorie des Historischen Institutionalismus, welcher auch unter dem Begriff Pfadabh?ngigkeit bekannt ist, geleitet. Ziel ist es herauszufinden, warum die beiden ?u?erlich sehr ?hnlichen europ?ischen Politikfelder eine so unterschiedliche Reformf?higkeit aufweisen. Insbesondere soll die Frage gekl?rt werden, warum die EU-Agrarpolitik ��ber Jahrzehnte hinweg so reformresistent ist. Es wird gezeigt, dass institutionalisierte Politiken sind keineswegs ?immer�� oder auch nur in gleicher Weise anf?llig f��r pfadabh?ngige Entwicklungen. Entscheidend sind die konkreten Opportunit?tsstrukturen, die im Zuge der Politikgestaltung errichtet werden und Default-Bedingungen unterschiedlich auspr?gen bzw. Akteuren in unterschiedlicher Weise Vetopositionen verleihen. Bei der EU-Regionalpolitik haben die Geberl?nder einen wirksamen Hebel in der Hand, mit dessen Hilfe Anpassungen an ver?nderte Rahmenbedingungen erzwungen werden k?nnen. Bei der EU-Agrarpolitik haben die Nehmerl?nder eine Vetoposition, mit deren Hilfe Anpassungen an ver?nderte Rahmenbedingungen verhindert werden k?nnen.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus4-3957
Soziale Beziehungen und Schulerfolg : die Bedeutung sozialer Beziehungen f��r Schulerfolg im Primar- und Sekundarbereich / von Monja Schmitt
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2012
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 5)
ISBN 978-3-86309-080-7
Preis: 20,00 �
Die vorliegende Dissertation befasst sich mit der Rolle sozialer Beziehungen f��r Bildungserfolg im Primar- und Sekundarbereich des deutschen Bildungssystems. W?hrend in bildungssoziologischen internationalen Untersuchungen Aspekte sozialen Kapitals bereits ��ber einen l?ngeren Zeitraum hinweg gro?e Beachtung finden, wird in bildungssoziologischer nationaler Forschung die soziale Umgebung dahingehend vernachl?ssigt, dass bislang kaum umfassende Untersuchungen zum Zusammenhang innerfamilialer und au?erfamilialer sozialer Beziehungsgef��ge und Bildungserfolg existieren. Ziel dieser Dissertation ist deswegen, einerseits zu pr��fen, inwiefern die in internationaler Forschung herangezogenen theoretischen Annahmen auf das deutsche Bildungssystem ��bertragbar und damit auch die Befunde internationaler Forschung replizierbar sind. Auf der anderen Seite werden auch die international eher vernachl?ssigten l?ngsschnittlichen Aspekte n?her untersucht. Die Befunde weisen darauf hin, dass sowohl die Eltern-Kind-Interaktion als auch soziale Beziehungen au?erhalb der Familie einen ma?geblichen Beitrag zur Erkl?rung schulischen Erfolgs leisten k?nnen. Dabei ist es im Primarbereich insbesondere wichtig in ein konstant intaktes Netz sozialer Beziehungen eingebunden zu sein und nicht erst unmittelbar vor dem ?bergang eine Verbesserung dieser Beziehungen zu erreichen. W?hrend zu diesem Zeitpunkt sowohl das elterliche Engagement innerhalb und au?erhalb der Familie als auch die sozialen 188bet������������_188����ƽ̨-Ͷע*����e der Kinder im schulischen Kontext gleicherma?en von Bedeutung sind, werden im Sekundarbereich zunehmend die Beziehungen der Kinder selbst wichtig.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus-4090
Weltkultur am Werk? : das globale Modell der Gesundheitspolitik und seine Rezeption im nationalen Reformdiskurs am Beispiel Polens / von Monika Elisabeth Radek
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2011
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 4)
ISBN 978-3-86309-041-8
Preis: 23,50 �
Wie aus dem Titel hervorgeht, steht im Fokus der Arbeit die Wirkungsweise der ?Weltkultur�� �C ein Begriff aus dem soziologischen Neoinstitutionalismus, der f��r eine globale Diffusion kognitiver Modelle steht, die sich kontraintuitiver Weise weltweit verbreiten, ohne dass ein ?Weltstaat�� daf��r Sorge tr?gt. Der urspr��ngliche Ausgangspunkt dieser Fragestellung liegt in der Besch?ftigung mit dem wohlfahrtsstaatlichen Wandel in der Systemtransformation in Mittelosteuropa. Seit Mitte der 1990er Jahre ist hier ein interessantes Ph?nomen zu beobachten: Die Zunahme einer evaluativ und beratend angelegten Forschung insbesondere ?konomischer Provenienz, die sich nicht die Beobachtung und Analyse der Wohlfahrtsstaaten zum Ziel setzt, sondern deren proaktive Ver?nderung im Einklang mit dem vorherrschenden ?konomischen Wissen. Mit der Wirkungsweise ��bergreifender kognitiver Modelle und Bedeutungsstrukturen auf Nationalstaaten besch?ftigen sich die Neoinstitutionalisten seit den 1980er Jahren. Dennoch bleiben viele Fragen offen bzw. kontrovers. Wie muss man sich die Wirkungsweise der ?Weltkultur�� auf nationalstaatlicher Ebene vorstellen? Kann es sich um eine einseitige Wirkungsrichtung handeln? Und wie lassen sich kulturelle Prozesse forschungspraktisch ��berhaupt ad?quat erfassen? Das Ziel der Arbeit besteht darin, diesen Fragen anhand einer empirischen Fallstudie nachzugehen. Der Analysefokus richtet sich dabei auf den Einfluss globaler Expertendiskurse auf den nationalen Reformdiskurs am Beispiel der Gesundheitspolitik in Polen. In einem ersten Schritt wird zun?chst das globale Modell der Gesundheitspolitik rekonstruiert und in eine historische Perspektive gestellt, um auf diese Weise Kontinuit?ten und Br��che des globalen Modells der Gesundheitspolitik aufzuzeigen. In einem zweiten Schritt wird in der polnischen Reformdebatte untersucht, inwieweit einzelne Bestandteile des globalen Modells hier rezipiert werden und wodurch diese Rezeption erm?glicht wird. Die Rekonstruktion des globalen Modells der Gesundheitspolitik f��hrt zu dem Ergebnis, dass die wichtigste Weiche f��r die Formierung der gesundheitspolitischen Wissensordnung der Gegenwart in der fortschreitenden ?Dezentrierung des Staates�� zu suchen ist. Im Zuge der diskursiven Entwicklung der letzten 30 Jahre wird eine radikale �C horizontale und vertikale - Neuverteilung der Gesundheitsverantwortung erreicht. Diese diskursive Entwicklung geht mit einer starken Aufwertung des Wissens und der Wissensproduktion einher, die sich die globalen Diskursteilnehmer selbst als ihre zentrale Aufgabe zuschreiben. Die Aufwertung des Wissens und der globalen Wissensproduktion geht dabei mit einer Abwertung der nationalen Entscheidungstr?ger einher, die als orientierungslos konstruiert werden. Im gesundheitspolitischen Reformdiskurs in Polen ist zun?chst zu beobachten, dass die kommunistische Erfahrung einem Diskurs der ?Staatsphobie�� zur Deutungsmacht verhilft, der wiederum die ?Dezentrierung des Staates�� stark beg��nstigt, wie sie im globalen Modell der Gesundheitspolitik rekonstruiert werden konnte. Der nationale Diskurs der ?Staatsphobie�� hat jedoch noch einen weiteren und f��r die forschungsleitende Fragestellung des Promotionsprojekts relevanten Effekt. Mit dem Diskurs der ?Staatsphobie�� verbindet sich auch die Forderung nach einer ?Entpolitisierung�� des Diskurses, die wiederum daf��r sorgt, dass �C ?meritorische�� �C Expertendiskurse eine starke Aufwertung erlangen. Gleichzeitig wird nationalen Diskursteilnehmern abgesprochen, ��ber Expertise zu verf��gen, so dass Expertise ��berwiegend internationalen Akteuren zugeschrieben wird. Der starke Einfluss internationaler Expertendiskurse auf nationale Reformpolitik ist in diesem Fall also auf die Komplementarit?t zweier diskursiver Entwicklungen zur��ckzuf��hren: Einerseits er?ffnet der Diskursverlauf auf globaler Ebene den globalen Wissensproduzenten die M?glichkeit, in der neuen Verteilung der Gesundheitsverantwortung einen festen und legitimen Platz einzunehmen. Andererseits wird diese Selbstaufwertung der globalen Arena im nationalen Diskurs best?tigt: Internationalen Aussagen wird tendenziell mehr ?Expertise�� und Autorit?t zugeschrieben als der ?Kritik�� nationaler Diskursteilnehmer. Nichtsdestotrotz sind keine 1:1-?bernahmen von Politikempfehlungen oder Deutungsmustern zu beobachten, was angesichts der Heterogenit?t des globalen Diskurses recht plausibel ist. Das bereits auf globaler Ebene stark umk?mpfte Modell der Gesundheitspolitik macht es auf nationaler Ebene m?glich, dass alle Diskursteilnehmer auf einzelne Versatzst��cke zur��ckgreifen und diese auch selbst im Einklang mit ihren Aussagen auslegen k?nnen. Die ��bergreifenden Bedeutungsstrukturen der ?Weltkultur�� sind also in gewisser Weise omnipr?sent, ihre Wirkung aufgrund ihrer Heterogenit?t jedoch trotz allem kaum steuer- und vorhersagbar.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus-3742
Brand Personalities and Consumer-brand Relationships as elements of successful brand management / von Katharina S. G��se
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2011
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 3)
ISBN 978-3-86309-000-5
Preis: 18,00 �
Diese Dissertation setzt sich mit den Konzepten Markenpers?nlichkeit und Konsumenten-Markenbeziehung auseinander, die zwei besonders wichtige Ma?e des Markenwertes sind. Diese Ma?e sind trotz ihrer Wichtigkeit noch nicht umfassend erforscht. Die vorliegende Dissertation besch?ftigt sich deshalb mit diesen Konzepten und gibt Hinweise dar��ber, wie Markenpers?nlichkeiten zu managen und zu messen sind, und wie stabile Konsumenten-Markenbeziehungen aufgebaut werden k?nnen. Dabei bietet diese Dissertation einen ?berblick ��ber den aktuellen Forschungsstand der Konzepte Markenpers?nlichkeit und Konsumenten-Markenbeziehungen, und zielt darauf ab, den Wissensstand in diesen beiden Forschungsgebieten zu erweitern, indem sie aktuelle Kritikpunkte aufgreift und in neuartigen Studien ber��cksichtigt.
Im Wesentlichen verfolgt diese Dissertation zwei Ziele: Zum Einen wird untersucht wie Markenpers?nlichkeiten von Konsumenten wahrgenommen werden. Ziel ist es, die Varianz der Wahrnehmung der Markenpers?nlichkeit zu erkl?ren. Nehmen alle Konsumenten die gleiche anvisierte Markenpers?nlichkeit wahr oder nehmen sie die gleiche anvisierte Markenpers?nlichkeit unterschiedlich wahr?
Die bestehende Skala zur Messung der Markenpers?nlichkeit (Aaker 1997) wird h?ufig kritisiert. Aus diesem Grund stellt diese Dissertation eine alternative Konzeptionalisierung der Markenpers?nlichkeit vor, die aus der Sozialpsychologie stammt. So wird in einem empirischen Modell die Rolle der Emotionen analysiert, die die Beziehung zwischen der Wahrnehmung der Markenpers?nlichkeit, der Einstellung gegen��ber der Marke und der Kaufabsicht mediiert.
Zum Anderen besteht das Ziel dieser Dissertation darin, zu verstehen wie Konsumenten Beziehungen zu Marken aufbauen. Zun?chst wurde eine detaillierte Literaturrecherche unternommen, um bisherige Forschungserkenntnisse abzubilden. Anschlie?end wurden die aus theoretischer Sicht als sinnvoll erachteten Variablen in einem empirischen Modell getestet.
In Anlehnung an das erste Ziel dieser Dissertation wird in der ersten Studie (Kapitel 2) die existierende Skala zur Messung der Markenpers?nlichkeit angewendet. Im Rahmen einer empirischen Untersuchung wird eine Taxonomie entwickelt, deren Dimensionen auf akademischen Forschungsergebnissen beruhen (Aaker 1997). Die Ergebnisse zeigen, dass Konsumenten, die eine starke Markenpers?nlichkeit wahrnehmen, eine positivere Einstellung gegen��ber der Marke haben, eine gr??ere Pr?ferenz f��r sie aufweisen und zufriedener mit der Marke sind.
Die zweite Studie (Kapitel 3) untersucht erstmalig die Anwendbarkeit des Stereotype-content Modells im Zusammenhang mit Konsumg��termarken. Bestehende Studien zum Thema Markenpers?nlichkeiten zweifeln an der Angemessenheit der Skala von Aaker. Daher beruht diese Studie im Gegensatz zu bisherigen Untersuchungen auf dem Stereotype-content Modell der Sozialpsychologie. Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass das Stereotype-content Modell eine wertvolle Alternative zum Konzept der Markenpers?nlichkeit darstellt. Die Studie leistet in zweierlei Hinsicht einen Forschungsbeitrag: Erstens zeigt sie auf wie die Komplexit?t der Messung der Markenpers?nlichkeit reduziert werden kann. Zweitens zeigen die Ergebnisse, dass die Kaufabsicht der Konsumenten von den Stereotypen gegen��ber der Marke, von Emotionen sowie von der Einstellung gegen��ber der Marke abh?ngt.
Im Hinblick auf das zweite Hauptziel dieser Dissertaton gibt Kapitel 4 einen ?berblick ��ber den Stand der Forschung zum Thema Konsumenten-Markenbeziehungen und zeigt aktuelle Forschungsl��cken auf. So wird zun?chst festgestellt, dass das Forschungsfeld um Konsumenten-Markenbeziehungen noch in seinen Anf?ngen steckt. Zweitens wird aufgezeigt, dass sich bisherige Studien zu Markenbeziehungen ausschlie?lich auf den Kontext zwischenmenschlicher Beziehungen beziehen.
Da Studien ��ber Markenbeziehungen aufgrund ihres Vergleiches mit zwischenmenschlichen Beziehungen h?ufig kritisiert wurden, schl?gt Kapitel 5 eine alternative Konzeptionalisierung vor, die Erkenntnisse aus der Literatur zum Beziehungsmarketing in den Konsumg��terbereich ��bertr?gt. Die Ergebnisse zeigen erstens, dass das Konstrukt Markenbeziehungsqualit?t durch die Dimensionen Commitment, Vertrauen und Zufriedenheit gebildet wird. Zweitens wendet diese Studie erstmalig die Relational Exchange Theory von Macneil (1980) im Zusammenhang mit Konsumg��termarken an. Das Normkonstrukt wird eingef��hrt und die Ergebnisse zeigen, dass relationale Normen eine mediierende Rolle in Konsumenten-Markenbeziehungen haben. Somit beantwortet diese Studie die von Johar (2005) gestellte Frage, ob Normen im Markenverhalten relevant sind. Au?erdem erweitert dieses Kapitel den Kenntnisstand ��ber Konsumenten-Markenbeziehungen, indem es ein umfassendes Modell empirisch testet. Dieses Modell schlie?t nicht nur Konsumenten- und Markencharakteristika mit ein, sondern ber��cksichtigt auch Charakteristika der Markenbeziehung als relevante Treiber der Beziehung. Die Ergebnisse zeigen, dass Konsumentencharakteristika einen signifikanten Einfluss auf relationale Normen haben, und dass die Charakteristika der Markenbeziehung vor allem das Ausma? der wahrgenommenen Markenbeziehungsqualit?t und der Markentreue beeinflussen.
Insgesamt bereichert diese Dissertation den Kenntnisstand ��ber die zwei zentralen Ma?e des Markenwertes, Markenpers?nlichkeit und Konsumenten-Markenbeziehung, wie folgt: W?hrend die erste Studie eine Taxonomie von Markenkonstellationen entwickelt, ��bertragen die beiden ��brigen empirischen Studien bestehendes Wissen einer Marketingdisziplin oder verwandter Disziplinen in den Markenkontext. Somit reduziert diese Dissertation einerseits Komplexit?t und bereichert andererseits die Forschung, indem sie Wissen, das sich in einem verwandten Kontext bew?hrt hat, in dem neuen Kontext anwendet.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus-3085
Numerische Klassifikation (Cluster Analyse) anhand nominaler, ordinaler oder gemischter Merkmale / von Prof. Dr. Friedrich Vogel und Dr. Rudolf Gardill
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2010
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 2)
ISBN 978-3-923507-80-1
Preis: 40,00 �
Numerische Klassifikation (oder Cluster Analyse) ist die Zuordnung einer Menge von Beobachtungen (Objekten) zu Teilmengen (Klassen oder Cluster), derart dass die Beobachtungen (Objekte), die einer Klasse angeh?ren, in einem bestimmten Sinne einander ?hnlich sind.
Diese Arbeit besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil behandelt die theoretischen Grundlagen unseres neuen Klassifikationsprogramms ORMIX. Zun?chst werden zwei Verfahren zur Bildung disjunkter Klassen er?rtert: ein Austauschverfahren und ein hierarchisch-agglomeratives Verfahren. Dann werden Ma?e zur Messung der G��te eines Klassifikationsergebnisses im Detail diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Merkmalstypen: nominal, ordinal und metrisch. Im Zusammenhang mit Problemen der Numerischen Klassifikation gibt es bei praktischen Anwendungen h?ufig gemischte Merkmale. Es wird gezeigt, wie eine G��tefunktion f��r gemischte Merkmale konstruiert werden kann.
Im zweiten Teil wird die Anwendung unseres Programms ORMIX beschrieben, das nominale, ordinale, metrische Merkmale und gemischte Merkmale verarbeiten kann. Die Konstruktion und das Einlesen der Datenmatrix wird im Detail erl?utert. Dann wird gezeigt, wie Datentransformationen (beispielsweise metrische in ordinale Merkmale) durchgef��hrt werden k?nnen. Nach diesen Transformationen kann eine hierarchisch-agglomerative Klassifikation oder eine iterative Klassifikation durch einen gestartet werden. Einige Beispieldateien finden sich auf der CD.
Die Bedienung des Programms ist einfach und meist selbsterkl?rend. Es k?nnen Berechnungen angesto?en und aus einer knappen Auflistung der Resultate ausf��hrliche Detaildarstellungen ausgew?hlt werden. Aus dem Wert einer G��tefunktion erh?lt man das Klassifikationsergebnis f��r die gew��nschte Anzahl von Klassen mit einer detaillierten Klassendiagnose. F��r die hierarchisch-agglomerative Klassifikation stehen zus?tzlich Dendrogramme und ein Struktogramm zur Auswahl.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus-2761
Anpassungen der deutschen Arbeitsverwaltung und Arbeitsmarktpolitik 1927 �C 2005 : Pfadabh?ngigkeit und Reformen / von Stefan Frank
Bamberg: Univ. of Bamberg Press, 2008
(Schriften aus der Fakult?t Sozial- und Wirtschaftswissenschaften der Otto-Friedrich-Universit?t Bamberg ; 1)
ISBN 978-3-923507-40-5
Preis: 16,50 �
Nach einer Analyse der Geschichte der Arbeitsverwaltung und der Arbeitsmarktpolitik zwischen 1927 und 2005 ist zu konstatieren, da? sich trotz zweier Regimewechsel und langer Perioden hoher Arbeitslosigkeit wichtige Strukturmerkmale der Verwaltung und ihrer Programme kaum ver?ndert haben. Aufgrund des gestiegenen Ver?nderungsdrucks infolge der hohen Arbeitslosigkeit seit den 70er Jahren und der diesen Trend nochmals verst?rkenden Wiedervereinigung sind anscheinend jedoch mit den letzten Reformen am Arbeitsmarkt einige dieser strukturbildenden Pfade verlassen worden.
Die Entwicklung auf dem Gebiet der Arbeitsverwaltung l??t sich daher in relativ stabile Pfade, die sich kaum ver?ndert haben, und in variable Pfade aufteilen, die aus unterschiedlichen Gr��nden ver?ndert oder aufgegeben worden sind.
Zugriff auf den Volltext:
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bvb:473-opus-1597